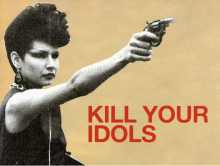Gedanken zum Thema Führung ... (Debatte um Führung, Teil 1)
Der folgende Text ist eine Reaktion auf Erzählungen vom Kollapscamp und die Forderung nach Führung durch einige Organisator*innen des Camps. Er wird in 4 Teilen veröffentlicht. Damit soll nicht in Frage gestellt werden, dass das Camp sicher gut und sinnvoll war, noch den Beteiligten ihr Engagement abgesprochen werden. Dieser Beitrag ist polemisch, aber von einer ehrlichen Wertschätzung motiviert, die allen Menschen gilt, welche sich sichtbar oder unsichtbar, langanhaltend oder eher punktuell, lokal oder transnational und in welchen Themenbereichen auch immer engagieren.
In vier Teilen will ich mich dem Thema Führung widmen, das auf dem Kollapscamp aufgekommen ist und nun im Nachhinein von den Organisator*innen gesetzt wird. Im Wesentlichen wollen sie das Paradigma der Hierarchiearmut und den Anspruch des Hierarchieabbaus in linken Bewegungen auflösen.
Die Argumentation beruht dabei - wie häufig bei Kadern - auf angeblicher Effektivität, fehlender Wertschätzung für Verantwortungsübernahme, den von einer zunehmend autoritären Gesellschaft gesetzten Erfordernissen an den Kampf und damit auf einem Primat des Politischen. Scully beschreibt diese Position im Text "The Tyranny of Leaderlessness" [> https://steady.page/en/disrupt/posts/3f4ac939-b805-431d-93e7-b8ff498f42429] und verlängert damit den Führungsanspruch Tadzio Müllers. Doch weil meine Gedanken dazu etwas ausgeufert sind, setze ich mich erst im dritten und vierten Teil mit diesem Text auseinander und formuliere hier vorab einige allgemeinere Gedanken.
Offenbar kam es beim Kollapscamp zu einem größeren Missverständnis. Während der Eröffnungszeremonie wurde der egozentrische, langjährige Klima-Aktivist Tadzio Müller in Szene gesetzt und beleuchtet, während es rundherum ganz finster war. Zudem hielt er seine Rede von einem erhöhten Platz und sollte offenbar dann „symbolisch“ das „Heft der Handlung an das Bewegungskollektiv“ weitergeben. Das Problem war aber: Er gibt es nicht weiter. Der Versuch der Dekonstruktion des Führers sollte tatsächlich auf perfide Weise seine Weihe zum Bischof der Kollapsbewegung werden.[1]
Denn wenn die ganze Debatte um „Leadership“ von Herrn Müller von vorne herein mit geplant war, kann es nicht gelingen, sie offen zu führen. Zwar mag er nach Orientierung suchende Anhänger*innen finden und Genoss*innen, die seine Aktivitäten schätzen und ebenso wie er nach der vielbeschworenen Handlungsfähigkeit sozialer Bewegungen suchen. Mit ihrer Thematisierung von „Leadership“ treffen sie und er auch wichtige Punkte, die in berechtigter Unzufriedenheit gründen, wie es hier und da in ihren linken Bewegungen gelaufen ist.
Zum Beispiel kann es einen zur Verzweiflung bringen, wenn man sieht, wie linke Gruppen entstehen und fallen, deren Aktivitäten kommen und gehen. Wenn Menschen sich aufgrund ihrer Erfahrungen und Kompetenzen in Kontexten linker Bewegung schämen und sie daher nicht produktiv in Gruppen einbringen können, ist dies ein herber Verlust. Wenn in unstrukturierten Debatten Dinge nicht systematisch angegangen werden und es scheinbar eher darum geht, sich selbst zu bearbeiten, eine gute Zeit zu haben und sich weniger verzweifelt zu führen – dann ist das eine Verwechslung dessen, worum es in selbstorganisierten Gruppen geht. Und schließlich ist es äußerst problematisch, wenn es in selbsterklärten „hierarchielosen“ Gruppen informelle Hierarchien gibt, die oft viel intransparenter, weniger sachlich kritisierbar, verhandelbar und abrufbar sind.
Nur sind die Schlussfolgerungen, die man aus derartigen Beobachtungen und Erfahrungen zieht, offen. Und man muss nicht zu jenen gelangen, zu denen Tadzio und seine Fans kommen, sondern kann im Gegenteil aus guten Gründen auf die Ebene der Strukturen schauen, statt nun offensiv Führerschaft zu fordern. In „linken Szenen“, wie sie derzeit (noch) in der BRD bestehen fordern im Wesentlichen nur Menschen Führerschaft, die sich selbst als Führer*innen berufen sehen. „Berufen“ ist hier das richtige Wort, denn Führer – auch wie sie den Kollaps-Orga-Menschen vorschweben – werden nicht gewählt: sie berufen sich selbst. Denn darin liegt gerade ihre Souveränität, die im Bereich des Politischen ein Pendant zum Genie-Kult um einsame Intellektuelle oder Künstler*innen ist.
Im Übrigen ist es auch nicht so, dass im Anarchismus jede Form von Führerschaft – im Sinne von Autorität – abgelehnt wird. Michael Bakunin führt beispielsweise aus, dass „natürliche Autorität“ gerechtfertigt sein kann, wenn sie (a) sich an der Kompetenz in Hinblick auf das entsprechende Thema festmacht, (b) transparent zu Stande kommt, (c) abberufbar – und damit situationsbezogen – ist, (d) keine weiteren Privilegien ermöglicht. Die Autoritäts-Projektionen auf Nestor Machno, Buonnaventura Durruti, oder auch auf Errico Malatesta und Emma Goldman, verdeutlichen, dass auch unter jungen Anarch@s durchaus das Bedürfnis vorhanden ist, zu folgen. Und wer sich etwas in der Szene herumgetrieben hat, wird auch auf einzelne Gewerkschafts-Bosse, Steetfighter-Macker und paternalistische Antimilitaristen getroffen sein... Schaut man genauer hin, wird allerdings schnell deutlich, dass es hierbei eher um eine Vorbildfunktion geht, statt um eine tatsächliche Führung und Gefolgschaft.
Unter Anarchist*innen in der BRD wurde die Diskussion nach 2019 mit der Gründung der Plattform geführt. In deren Gründungsdokument Über die Bedingungen, unter denen wir kämpfen und den Zustand der anarchistischen Bewegung wird nach der Gegenwartsanalyse die anarchistische Bewegung im deutschsprachigen Raum betrachtet. Konstatiert werden Strategielosigkeit, Beliebigkeit und Profillosigkeit, Desorganisation, Unzuverlässigkeit, Falsch verstandene Autonomie, die Haltung zur Gesellschaft und zur Revolution, das Fehlen einer offenen, solidarischen Kritik untereinander sowie eine öffentliche Unsichtbarkeit und schlechte Außenwirkung. Nun ist an all diese anarchistischen „Tugenden“ zweifellos etwas dran. Sie betreffen übrigens nicht nur anarchistische Gruppen, sondern viele Zusammenhängen, in denen Verbindlichkeit und Machtverteilung, Ziele und Kompetenzen völlig unklar sind.
Schade ist es jedoch, wenn ein rein negativer Fokus auf die sogenannte Bewegung gesetzt wird, um sich selbst als die Lösung zu präsentieren. Immerhin hätten die Autor*innen sich auch Beispiele suchen können, wo die Organisation auf tatsächlich hierarchiearme und weitgehend gleichberechtigte Weise funktioniert. Bezeichnenderweise stellen diese sich selbst nur nicht so heraus, sondern arbeiten eher im Hintergrund – wie die meisten radikalen, effektiven und langfristig angelegten Projekte. Zumal der plattformistische Lösungsansatz, eine vermeintlich disziplinierte, kohärente, verbindliche Organisation hinzubekommen, nur bedingt funktioniert hat. Wenn sich Gruppen daran aufbauen konnten, dann meiner Ansicht nach nicht wegen, sondern trotz des plattformistischen Kader-Ansatzes. Meiner Wahrnehmung nach ist die Analyse richtig, aber verkürzt. Darum sind die Schlussfolgerungen inkonsequent und der Anarchismus wird mit einer Reduktion auf das Modell von Polit-Gruppen in seinen eigentlichen Möglichkeiten beschnitten.
[1] „Ein weiterer, und für uns sehr schmerzhafter Fehler, war die Art und Weise, wie die sehr aktiven Diskussionen, die wir in unserer Orga über die Rolle von “Leadership” führen, im Eröffnungsevent rüberkamen. Unsere Idee war, Tadzios sehr, und in der öffentlichen Sichtbarkeit auf jeden Fall zu zentrale Rolle bewusst zu thematisieren, und symbolisch die Übergabe des Hefts der Handlung an an das Bewegungskollektiv – eine Übergabe, die in der realen Arbeit bereits weitgehend passiert ist – darzustellen. Das kam ganz offensichtlich bei ganz vielen überhaupt nicht rüber, die leise Ironie konnte kaum jemand merken, und am Ende fanden selbst wir, dass es an manchen Punkten auch ziemlich cringe war“ (Statement „Genoss*innen“ / Kollapscamp).
 Creative Commons by-nc-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen - nicht kommerziell
Creative Commons by-nc-sa: Weitergabe unter gleichen Bedingungen - nicht kommerziell